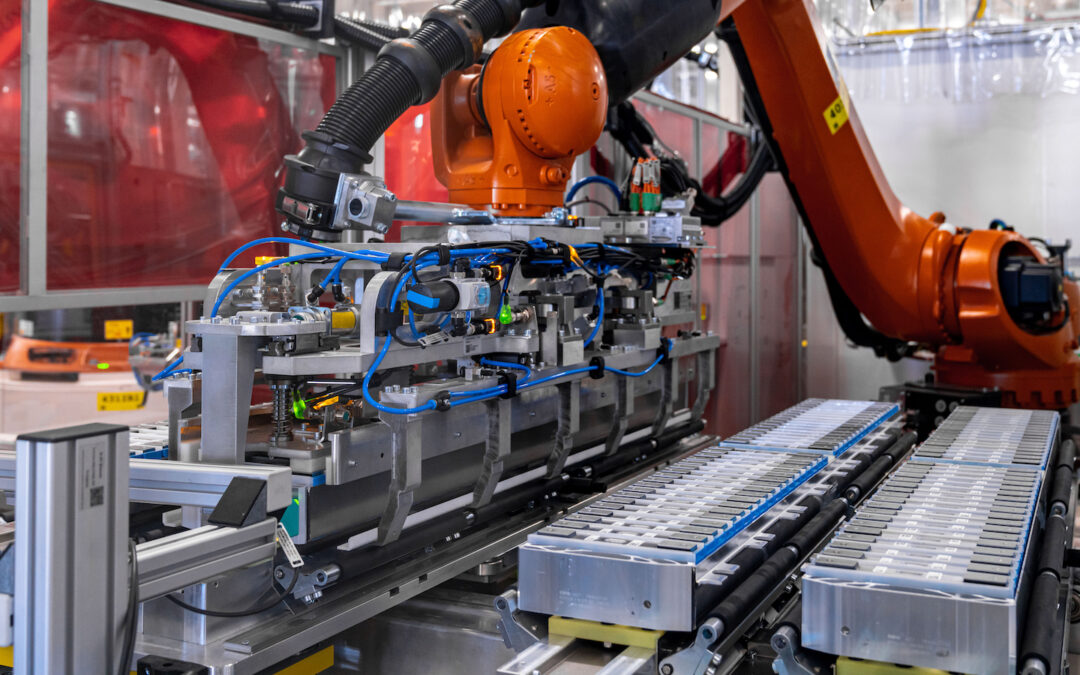Europäische Hersteller von Batterien haben es schwer. Und das, obwohl sich die welt weite Nachfrage nach Batterien bis 2030 mehr als verdreifachen wird. Zu diesem Ergebnis kommt der „Battery Monitor 2024/2025“ von Roland Berger und der RWTH Aachen. Demnach beherrschen derzeit technisch führende Produzenten aus Asien den Markt, vor allem aus China. Die Volksrepublik hat erhebliche Überkapazitäten und produziert weit über den eigenen Bedarf hinaus, die Überschüsse gehen in den Export.
„Das führt weltweit zu fallenden Preisen, die allerdings nicht auf Dauer so niedrig bleiben können“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner der Beratungsgesellschaft Roland Berger. Denn schon jetzt arbeiteten manche der Zulieferer und Produzenten in China nicht mehr kostendeckend. Dennoch setze der Preisverfall vor allem europäische Hersteller unter Druck, die am Aufbau eigener Kapazitäten arbeiten. Batterieunternehmen außerhalb Chinas verzeichneten zurzeit deutliche Verluste. Bernhart geht daher davon aus, dass nicht alle angekündigten Projekte tatsächlich realisiert werden – mit dem Risiko der Unterversorgung.
Wege aus der Krise
Die Planungen der europäischen Hersteller gestalten sich schwierig. So steige die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge aktuell langsamer als erwartet. Zudem sei es sowohl in den USA als in Europa ungewiss, wie es regulatorisch weitergeht. Auch seien die europäischen Hersteller wegen der höheren Produktionskosten unter Druck. Um zu den asiatischen Marktführern aufzuschließen, müssen die westlichen Hersteller laut der Analyse auf eine kostengünstige Massenproduktion hinarbeiten, hier böten sich auch Kooperationen mit asiatischen Unternehmen an.

Nach der Analyse der Experten gibt es an vielen Stellen der Wertschöpfungskette noch große Möglichkeiten, die Preise für eine Kilowattstunde Speicherkapazität mehr als nur zu halbieren. Grafik: Battery-Monitor 2024/2025 von Roland Berger
Derzeit fokussieren sich die europäischen Batteriehersteller vor allem auf Nachhaltigkeit, um sich von ihren chinesischen und US amerikanischen Wettbewerbern abzusetzen. So haben sie sich das Ziel gesetzt, die Emissionen bei der Herstellung von Batteriezellen auf 30 bis 40 Kilogramm CO2 pro kWh zu senken. Das entspricht etwa einem Drittel bis der Hälfte des aktuellen CO2-Fußabdrucks von Batteriezellen. Die Studienautoren halten dieses Ziel durchaus für realistisch. Damit – sowie mit Wettbewerbsvorteilen bei Innovationen und hochwertigen Prozesstechnologien – habe Europa das Potenzial, sich zu einem wichtigen Akteur in der Batterieherstellung zu entwickeln.
Hochlauf langsamer als erwartet
Die Studienautoren haben drei Prognosen für die Entwicklung des Bedarfs erstellt: In einem Positiv-Szenario, das auf den Zielen der Automobilhersteller basiert und ein schnelles Fortschreiten der Elektrifizierung der Fahrzeugflotten annimmt, steigt die Nachfrage nach Antriebsbatterien bis 2030 auf eine Kapazität von 4,6 Terawattstunden (TWh). Das entspricht allerdings 0,3 TWh weniger als im letztjährigen „Battery Monitor“ prognostiziert. Bis 2040 könnte die Nachfrage dann auf 8,8 TWh zulegen.
Das Basis-Szenario sieht eine Nachfrage im Jahr 2030 bei 4,3 und im Jahr 2040 bei 8,6 TWh. Im schlechtesten Fall, einem Negativ-Szenario mit deutlichen Verzögerungen etwa durch eine Verschiebung des für 2035 geplanten „Verbrenner-Verbots“ in der EU, läge die Nachfrage nach Batterien 2030 nur bei 4,0 und in 2040 bei 8,1 TWh.